
| Autoren | Glossen | Lyrik |
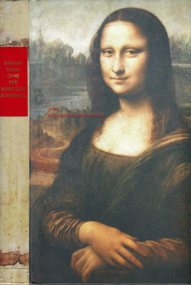 Deborah Dixon
Deborah Dixon
Der Mona Lisa Schwindel.
Aus dem Nachlass ediert, aus dem Amerikanischen übersetzt und samt einem Nachwort von Werner Fuld
Eichborn Verlag 2011, 318 Seiten
ISBN 978-3-8218-6245-3
Der Plot scheint bekannt: Jemand stöbert im Nachlass eines verstorbenen Freundes und stößt dabei auf ein Geheimnis, das – sollte es gelüftet werden – aufsehenerregende und nicht selten skandalöse Erkenntnisse zu Tage treten lassen würde. In unserem Fall ist dieser Jemand jedoch Deborah Dixon, eine renommierte Kunsthistorikerin des Metropolitan Museum of Art, deren verstorbene Freundin Laura ihr Tagebücher und Aufzeichnungen hinterlassen hat, die Unglaubliches behaupten. Laura war die Gattin Eduardo de Valfiernos, eines zwielichtigen Kunsthändlers, der 1911 in den spektakulärsten Kunstraub der neueren Zeit verwickelt gewesen ist.
Am Montag, den 21. August 1911, verschwindet die weltberühmte Mona Lisa [1] aus dem Louvre, entdeckt wird der Diebstahl einen Tag später, der Montag ist der Ruhetag des Museums, Besucher haben keinen Zutritt zu den Ausstellungsräumen. Eine hektische Fahndung beginnt, in deren Verlauf auch Apollinaire und Picasso in Verdacht geraten [2]. Die fehlenden Sicherheitsvorkehrungen [3] und der schlampige Umgang mit den Ausstellungsstücken werden aufgedeckt und angeprangert. Nach zweieinhalb Jahren meldet sich der ehemalige Glaser Vincenzo Peruggia bei einem italienischen Kunsthändler und bietet ihm die Mona Lisa zum Kauf an. Der informiert die Polizei, Peruggia wird verhaftet, zu 7 Monaten Gefängnis verurteilt, die Mona Lisa kehrt einige Monate später in den Louvre zurück.
Soweit die offizielle Version. Aber ist das auch die Wahrheit? Hat es sich so zugetragen? Laura de Valfierno weiß es besser und Deborah Dixon findet ihre Angaben – nach anfänglichem Zögern und intensiver Recherche – bestätigt. Denn der eigentliche Coup des Verbrechens war nicht der Diebstahl der Mona Lisa, der war nur der Auslöser für etwas viel Raffinierteres.
Valfierno hatte durch den Kunstfälscher Yves Chaudron vier Kopien der "Gioconda" (oder La Joconde, wie die Mona Lisa auch genannt wurde) anfertigen lassen, die er an reiche Kunstsammler verkaufen wollte. Da keiner dieser Sammler mit dem Erwerb des Bildes an die Öffentlichkeit treten könnte, es handelte sich schließlich um Hehlerware, bestand kaum Gefahr, dass der Schwindel auffliegen würde. Das Original behielt er selbst.
Wenn es so gewesen ist, was hängt jetzt im Louvre? Eine Kopie! Angefertigt von einem beim Museum angestellten Kopisten [4]. Peruggia [5], der angebliche Dieb, wurde zu seinem Geständnis erpresst, da man ihm die Beteiligung an einer Demonstration nachweisen konnte, bei der ein Polizist ums Leben gekommen war [6].
Das Buch ist eine Collage aus dem Entwurf eines Drehbuchs, an dem Erich Maria Remarque und Orson Welles im Herbst 1942 gearbeitet haben, das jedoch nie fertig gestellt worden ist, und den akribischen Recherchen von Deborah Dixon. Es ist amüsant, spannend und lehrreich, da es Hintergründe des Kunsthandels und einiger Biographien erwähnter Personen erhellt. Die Provenienz des Gemäldes wird kritisch hinterfragt, die Diskussion zur Identität der dargestellten Frau wird ebenso ausführlich behandelt wie die Arbeitsmethoden in der Werkstatt Leonardos.
Aber natürlich gibt es Zweifel an den Erkenntnissen Deborah Dixons, ist der Mona Lisa Schwindel selbst ein Schwindel? Werner Fuld, dem das Manuskript des Buches nach dem Tod der Autorin angeboten worden ist, trat in der Vergangenheit als Herausgeber eines Lexikons der Fälschungen in Erscheinung [7], Orson Welles drehte 1973 F for Fake [8], eine Zusammenarbeit mit Erich Maria Remarque ist nicht verbürgt, und wer war Yves Chaudron, der vermeintliche Fälscher [9]? Wo sind die vier Kopien geblieben, die er angefertigt haben soll, wer waren die Käufer [10]? Und würde man Deborah Dixon kennen, wenn man im Metropolitan Museum of Art nach ihr fragen würde? Fuld in seinem Nachwort: "Die Realität wird so gebrochen, dass sie ihre Eindeutigkeit verliert, aber nichts von ihrer Wirklichkeit einbüßt." (S. 316)
Sei es wie es sei: Tatsache ist, dass sich die Leitung des Louvre bisher standhaft geweigert hat, die Mona Lisa mit wissenschaftlichen Methoden untersuchen zu lassen, um den Verdacht zu entkräften, dass es sich bei dem ausgestellten Bild um eine Fälschung handelt.
----------------------------
1. "Doch gerade dieses Fehlen aller Charakteristika, diese seltsame Entindividualisierung konnte sie zum Typus des unergründlichen weiblichen Wesens schlechthin machen – allerdings erst, seit in der Mitte des 19. Jahrhunderts durch die Romantik ein neues Frauenbild entstand. In den vier Jahrhunderten davor war das Gemälde nahezu unbekannt und wurde auch von Kunstkennern nicht geschätzt." S. 135
2. Picasso war im Besitz von zwei aus dem Louvre gestohlenen iberischen Statuen, die er von dem Dieb Géry Pieret gekauft hatte, der wiederum mit Apollinaire gut bekannt ist. Im anschließenden Prozess, in dem sich Apollinaire und Picasso gegenseitig belasten, wird jedoch klar, dass sie mit dem Raub der Mona Lisa nichts zu tun haben.
3. "Es fehlten einhundertdreiundzwanzig Bilder und Kunstgegenstände", wie man bei einer Revision feststellte. S. 140
4. Frederic Auguste Laguillermie (1841 – 1934), Kopist und Graveur. "Laguillermie hat die Tafel in gerahmtem Zustand übermalt, also wohl in jenem Rahmen, mit dem sie aus dem Magazin kam. Man sieht das, weil um die ganze Tafel herum ein fast ein Zentimeter breiter Rand verläuft, der von einem Wulst aus Farbe begrenzt wird. Aus zeitgenössischen Kopien weiß man, dass das Porträt der Mona Lisa ursprünglich von zwei Säulen der Loggia eingerahmt war. Bei einer späteren Einpassung in einen Rahmen wurde die Tafel seitlich beschnitten, so dass die Säulen wegfielen. Durch die Farbwülste wird jedoch deutlich, dass die Tafel, die heute noch im Louvre hängt, nicht beschnitten ist, sondern eine Kopie des Zustandes von 1911 darstellt." S. 181
5. Vincenzo Peruggia (1881 – 1925) war eine Zeit lang als Glaser im Louvre angestellt, kannte also die Örtlichkeiten bestens. Er soll als Einzeltäter gehandelt haben und das Gemälde 2 Jahre lang in seiner Kammer verborgen haben. Die Polizei hatte ihn schon kurz nach der Tat befragt, ihn aber nicht für verdächtig gehalten. Schließlich soll er das Bild einem italienischen Kunsthändler angeboten haben, der daraufhin die Polizei verständigte. Im Prozess gab er als Motiv an, die Mona Lisa an ihren rechtmäßigen Heimatort zurück bringen zu wollen. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und 15 Tagen Haft. Der Verteidiger legte Berufung ein, das Urteil wurde daraufhin auf sieben Monate und acht Tage verkürzt.
6. Anlässlich der Hinrichtung Jean-Jacques Liabeufs fand am 1. Juli 1910 in Paris eine Demonstration mit ca. 10.000 Teilnehmern statt, bei der auch Picasso und Lenin anwesend gewesen sein sollen. Liabeuf war zum Tode verurteilt worden, weil er am 8. Januar 1910 einen Polizisten erschossen und einige andere verletzt hatte aus Rache für eine als ungerecht empfundene Verurteilung wegen Zuhälterei. Bei dieser Demonstration wurde ein Polizist erstochen.
7. Er war auch einer der Herausgeber von "Sag mir, daß du mich liebst", in dem die Beziehung Erich Maria Remarques zu Marlene Dietrich behandelt wird.
8. Hier tritt auch der Kunstfälscher Elmyr de Hory auf, der auch in Der Mona Lisa Schwindel eine Rolle spielt, wenn auch nur eine bescheidene. F for Fake ist über weite Strecken selbst ein Fake.
9. Der Name taucht erstmals in einem Artikel Karl Deckers (1868 - 1941) in der Saturday Evening Post vom 25. Juni 1932 als Komplize Valfiernos auf. Demnach fertigte er 6 Kopien der Mona Lisa an.
10. Valfierno veräußerte die Kopien an John Jacob Astor (der mit seiner frisch angetrauten Ehefrau die Flitterwochen in Europa verbrachte), Benjamin Guggenheim (dessen Tochter Peggy ein skandalträchtiges Leben als Kunstsammlerin führte), Natalie Barney (Millionenerbin, Autorin und Gründerin eines literarischen Salons in Paris, in dem auch Proust verkehrte) und John Pierpont Morgan (bis 1913 Präsident des Metropolitan Museum of Art, in dem unsere Autorin später so erfolgreich tätig sein sollte). Sie alle waren Passagiere auf der Titanic, die in der Nacht zum 15. April 1912 im Meer versank.
----------------------------
25. Mai 2020
→ Kunst