
| Autoren | Glossen | Lyrik |
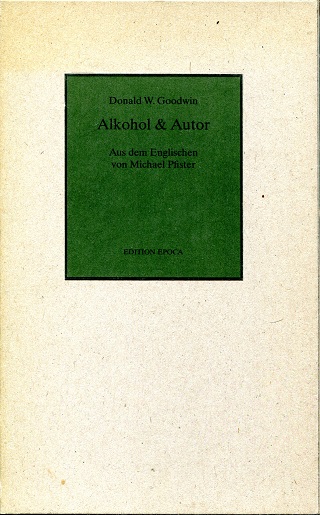 Donald W. Goodwin:
Donald W. Goodwin:
Alkohol & Autor.
Aus dem Englischen von Michael Pfister.
Edition Epoca 1995, 301 Seiten
ISBN 3-905513-00-5
Bis zum Ende der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gab es 7 US-amerikanische Nobelpreisträger für Literatur: Sinclair Lewis, Eugene O'Neill, Pearl S. Buck, William Faulkner, Ernest Hemingway, John Steinbeck und Saul Bellow (Isaac Bashevis Singer, der den Preis 1978 erhielt, zählt Goodwin nicht dazu, da er in Polen geboren wurde und ausschließlich auf jiddisch geschrieben hat). 5 von ihnen waren Alkoholiker (Lewis, O'Neill, Faulkner, Hemingway, Steinbeck). Dieser hohe Anteil veranlasste Goodwin zu weiteren Recherchen und er kam zu dem Schluss: "Mit den Jahren wuchs meine Überzeugung, daß der Alkoholismus unter (amerikanischen) Schriftstellern einer Epidemie gleichkommt." S. 12
Konkret untersucht er dieses Phänomen an Leben und Werk von 8 Autoren, von denen 6 Amerikaner waren:
Edgar Allan Poe, bei dem sich Phasen der Abstinenz mit Exzessen abwechselten, er verlor mehrere Anstellungen durch seinen übermäßigen Alkoholkonsum. Persönliche Tragödien (beide Eltern starben bevor er 4 Jahre alt war, Tod seiner Frau) mögen seine Anfälligkeit noch befördert haben. Die Auseinandersetzung darüber, ob Poe überhaupt Alkoholiker gewesen ist, ist auch heute noch nicht verstummt, Goodwin bejaht es uneingeschränkt. Behauptungen, Poe sei darüber hinaus opiumabhängig gewesen, bezeichnet er als Spekulation, allerdings hält er es für möglich, dass Poe durch übermäßigen Absinthgenuss massive psychische Störungen davon getragen haben könnte. Man fand Poe eines Tages verwahrlost und desorientiert auf der Straße, wenige Tage später war er tot.
F. Scott Fitzgerald, der gerne mit seiner Trinkerei posierte und sie übertrieb. Die Widersprüchlichkeit seines Charakters wurde durch seinen Alkoholismus noch ausgeprägter, er geriet mit seinen Freunden und seiner Frau, Zelda Fitzgerald, immer wieder in Streit deshalb, seine Gesundheit litt, sein Wesen änderte sich, am Ende erlag er – 44jährig – einem Herzinfarkt.
Ernest Hemingway, der trinkfeste Großwildjäger, verharmloste seine Abhängigkeit, war aber tatsächlich auch in der Lage kontrolliert zu trinken, wenn er an einem literarischen Projekt arbeitete. Zunehmend litt aber seine körperliche und geistige Gesundheit unter den Exzessen, denen er sich immer wieder hingab. In den letzten Jahren seines Lebens litt er an Depressionen, verbunden mit Wahnvorstellungen, die auch durch eine Reduzierung seines Alkoholkonsums nicht mehr gelindert werden konnten. Wenige Tage nach der Entlassung aus einer psychiatrischen Klinik nahm er sich das Leben.
John Steinbeck, gilt gemeinhin als starker Trinker, jedoch nicht als Alkoholiker. Goodwin untersucht anhand einer umfangreichen Biografie von Jackson J. Benson (die leider nie in deutscher Übersetzung erschienen ist), die Trinkgewohnheiten Steinbecks mittels 20 Fragen, die zu Goodwins Zeiten als Maßstab zum Nachweis von Alkoholismus galten. Demnach wäre Steinbeck "mit hoher Wahrscheinlichkeit" Alkoholiker gewesen.
William Faulkner entstammt einer Familie von Trinkern, seine Ehefrau war ebenfalls Trinkerin. Nach ersten literarischen Erfolgen schrieb er zahlreiche Drehbücher für Hollywood-Produktionen, in deren Vorspann nicht einmal sein Name erwähnt wurde. Sein literarischer Ruhm dagegen wuchs und gipfelte 1949 in der Verleihung des Nobelpreises für Literatur. 1962 begab er sich in ein Sanatorium, wo er einen Herzschlag erlitt und starb. "Von Beginn seiner Adoleszenz bis zum Tag vor seinem Tod trank er." (S. 166) Er gab sich tagelangen alkoholischen Exzessen hin, lebte immer mal wieder für kurze Zeit abstinent, um schließlich umso schlimmer abzustürzen.
Eugene O'Neill entsagte mit 37 Jahren nach einer sechswöchigen psychoanalytischen Behandlung vollständig dem Alkohol (von einigen Abstürzen abgesehen). Er stammte aus einer irischen Alkoholikerfamilie. O'Neill kam schon als Kind in Kontakt mit Alkohol, sein Konsum nahm als Jugendlicher bedenkliche Ausmaße an und steigerte sich noch als Erwachsener.
Außerdem
Georges Simenon, der zwar in Belgien geboren wurde und lange in Frankreich lebte, dessen Alkoholkonsum aber erst in den USA – seiner eigenen Aussage nach – zum Problem wurde. Er stammte aus einer alkoholfeindlichen Familie, trank jedoch mit 14 erstmals Alkohol und fand Gefallen daran. Trank in Frankreich viel und regelmäßig, soll aber selten betrunken gewesen sein. Nach dem Krieg lebte er in den USA und die dortigen Trinkgewohnheiten führten zu immer häufiger auftretenden Exzessen. Als er sich selbst als Alkoholiker zu begreifen begann, reduzierte er seinen Konsum beträchtlich und lebte zeitweise völlig abstinent.
Malcolm Lowry, ein Engländer, der ebenfalls lange in den USA gelebt hat. Er trank seit seiner Jugend fast täglich Alkohol in größeren Mengen. In den Jahren in einer Hütte in Kanada, wo er mit seiner zweiten Frau lebte, hatte er seine Trinkerei einigermaßen unter Kontrolle. Sein gesamtes Werk ist Ausdruck seiner Abhängigkeit. Außer seinem Hauptwerk "Unter dem Vulkan" und einem Jugendwerk wurde zu seinen Lebzeiten nichts von ihm veröffentlicht. Er hinterließ eine Vielzahl unvollendeter Manuskripte als er nach einer Flasche Gin und einer Überdosis Schlaftabletten starb.
Dass alle Genannten Alkoholiker gewesen sind, daran besteht für Goodwin kein Zweifel. Sonst aber bleibt vieles vage in seinen Ausführungen. Welchen Einfluss hatte der Alkohol auf das Werk der Autoren, schrieben sie besser im Suff oder trocken? Lässt sich das in der Analyse der Werke nachweisen oder wenigstens vermuten? Besteht ein kausaler Zusammenhang zwischen Alkoholismus und psychischen Störungen, unter denen die Autoren alle mehr oder weniger gelitten haben? Waren die Psychosen Folge der Exzesse oder war es vielleicht doch eher umgekehrt? Zum Teil widersprechen sich die Angaben Goodwins erheblich: Autoren, die seit ihrer Jugend keinen Tag ohne erhebliche Mengen Alkohol gelebt haben sollen, beenden ihre literarischen Projekte dann aber doch diszipliniert und abstinent. Das mindert den Wert der Lektüre leider, vielleicht ist das aber auch bloß Korinthenkackerei, und man sollte das Buch einfach als einen weiteren Beitrag zum großen Thema Rausch und Literatur betrachten.
11. Oktober 2022